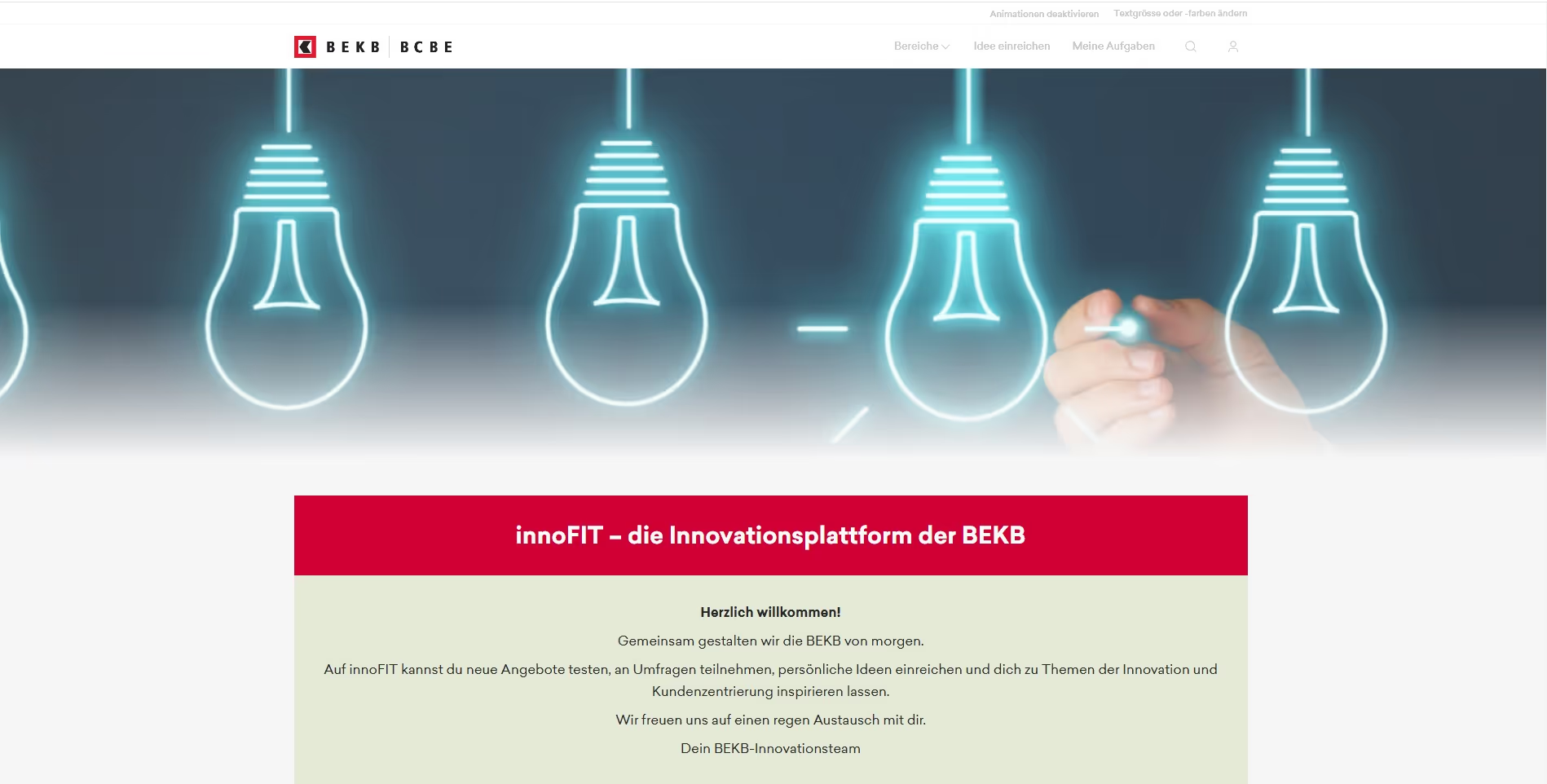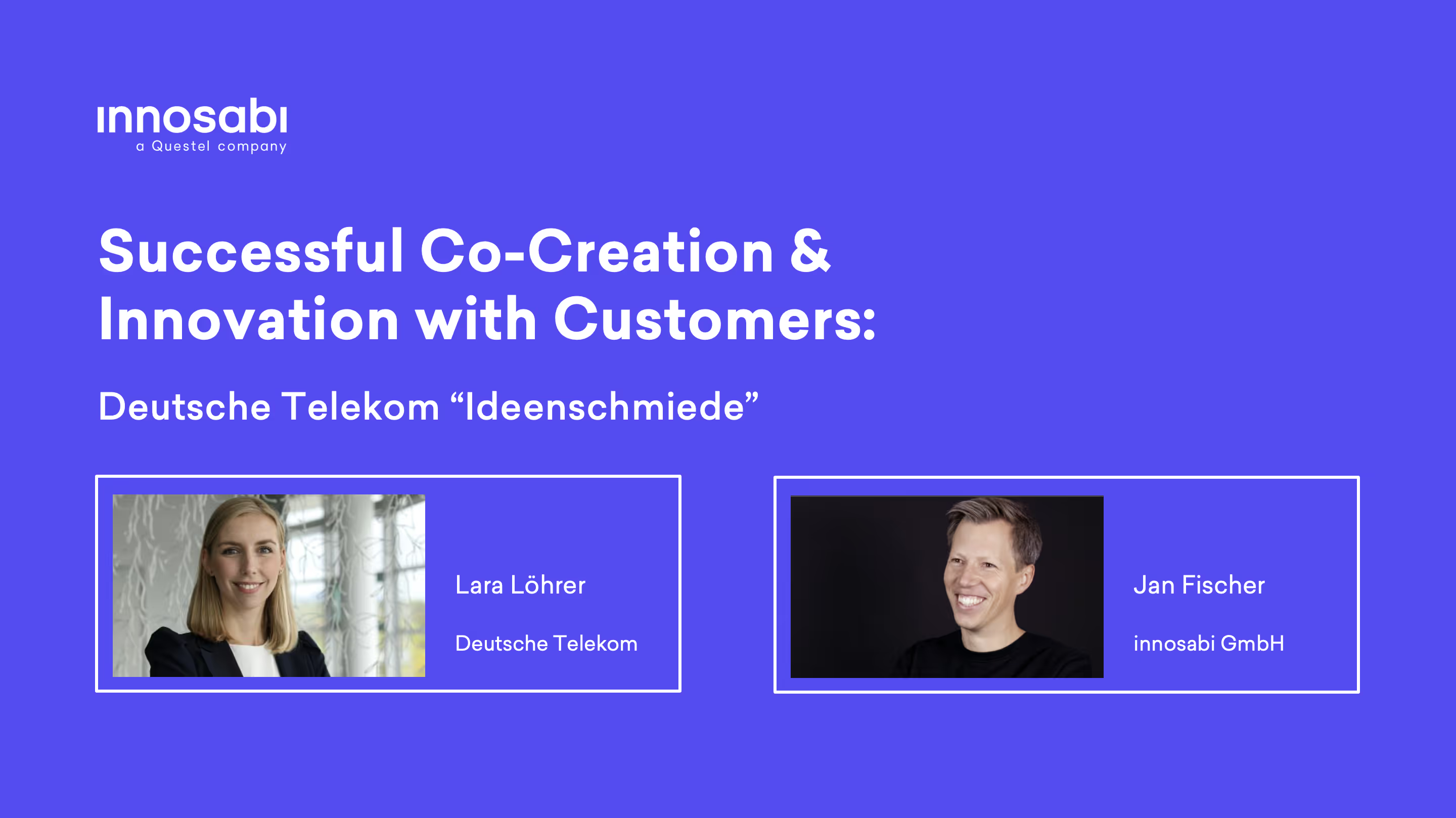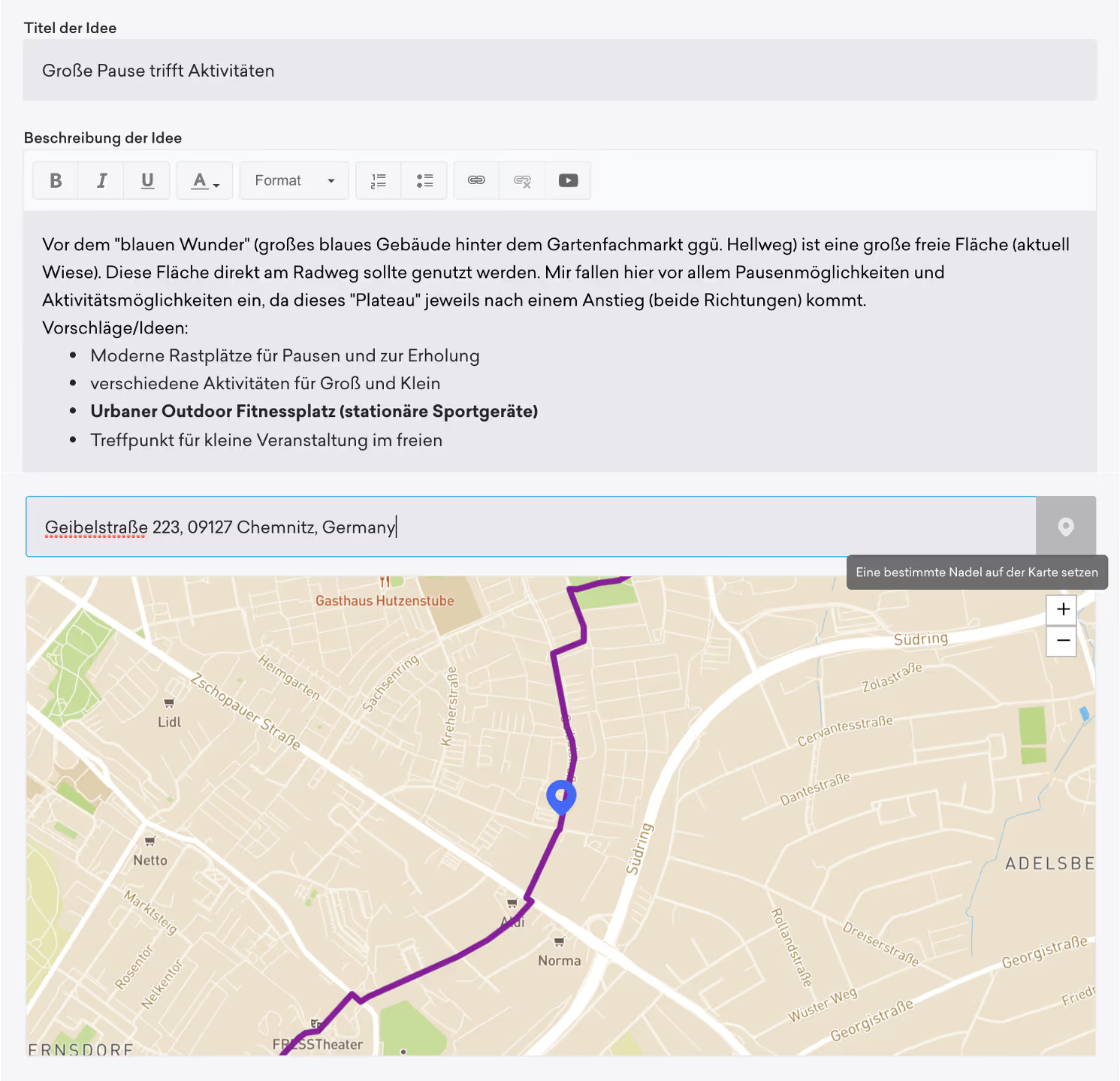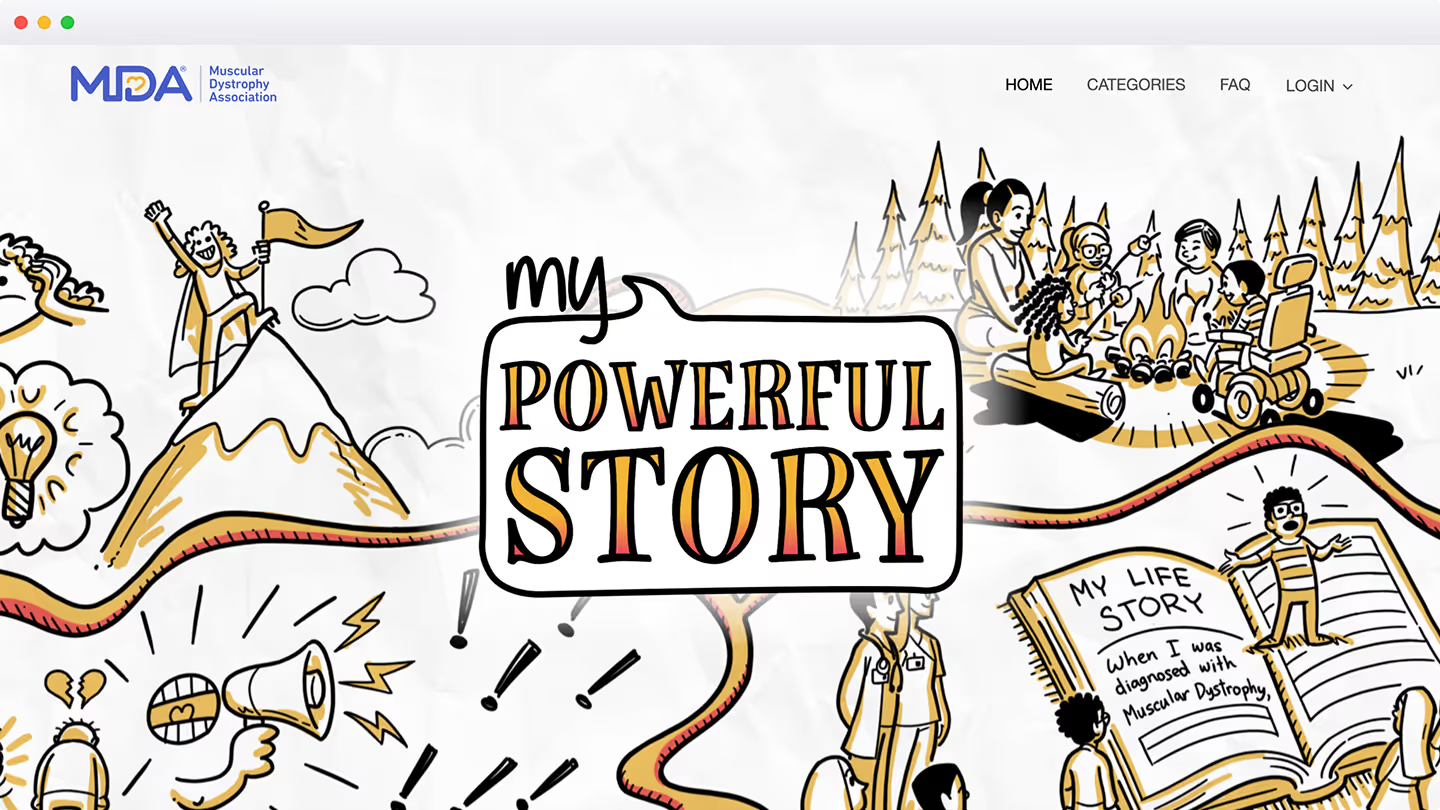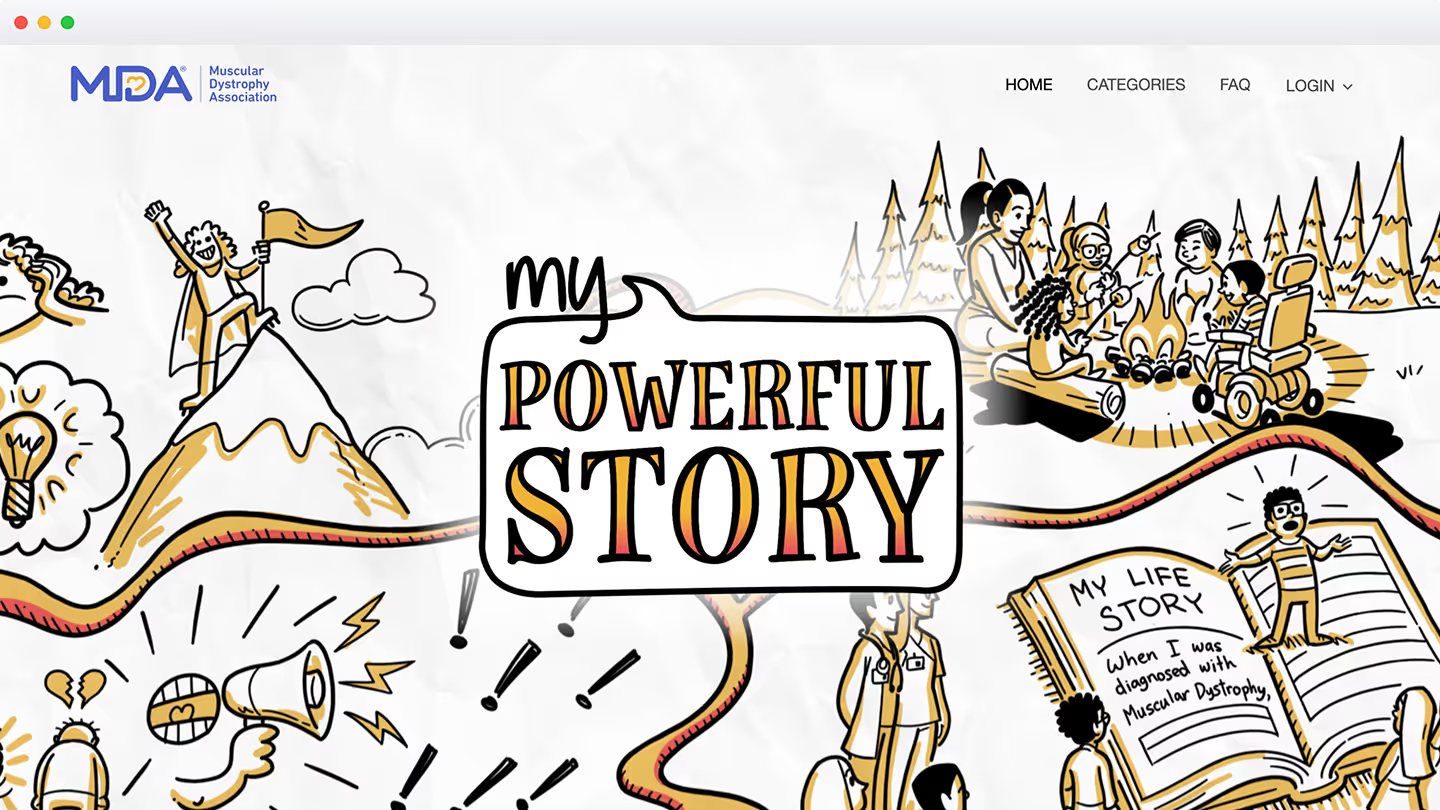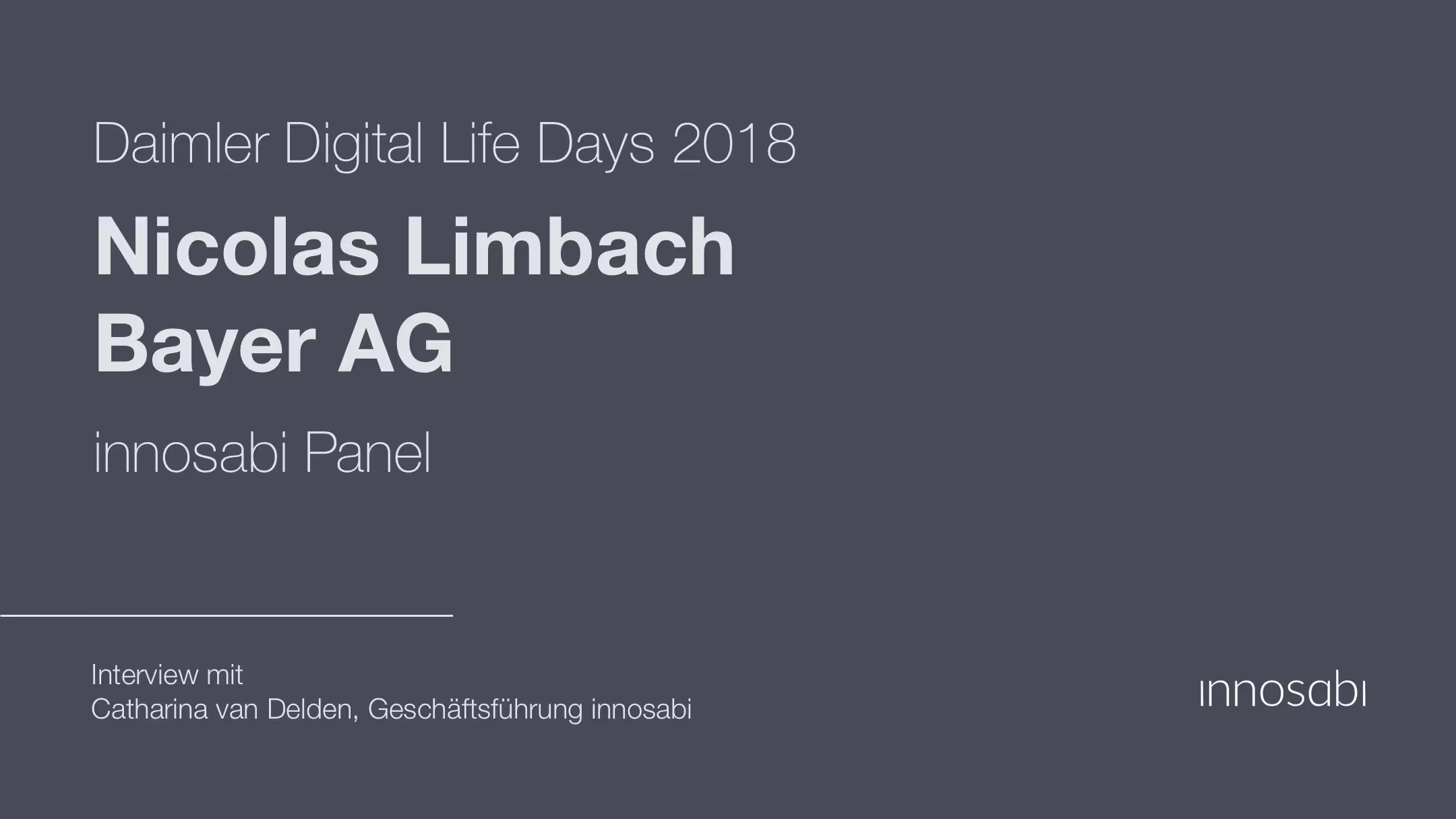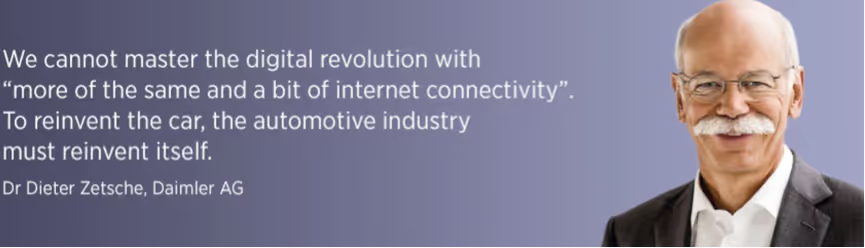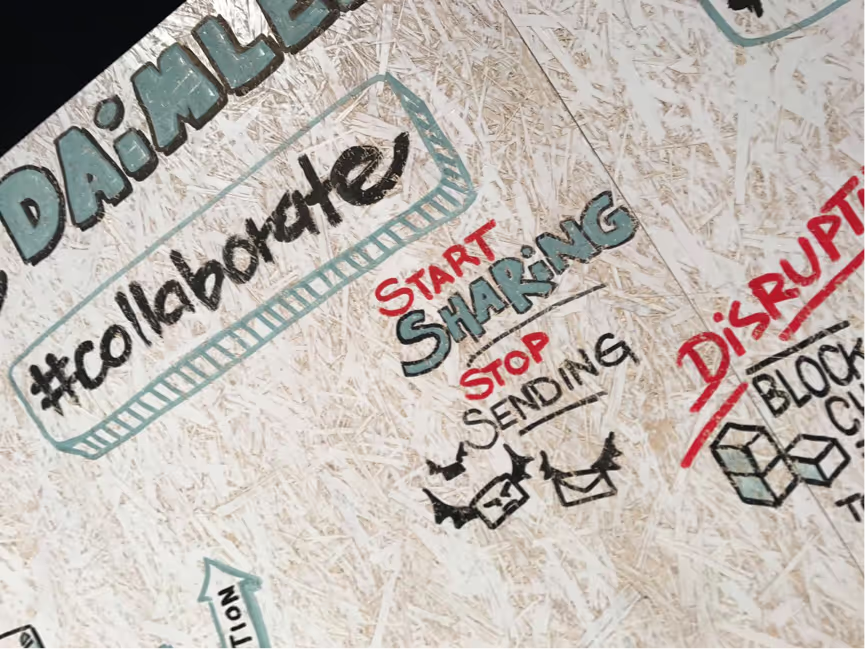Die meisten Innovationsprogramme konzentrieren sich auf Tools, nicht auf Menschen. Und genau dort entstehen häufig die größten Schwachstellen.
Unternehmen investieren stark in Tools wie Ideenplattformen, Analytics oder automatisierte Workflows. Doch die emotionale Erfahrung der Mitarbeitenden hinter diesen Ideen wird oft übersehen.
RHI Magnesita, ein global führendes Unternehmen für Feuerfestprodukte, teilte kürzlich seine People-First-Strategie in einem Webinar mit innosabi zum Thema „Turning Challenges into Breakthroughs“. Das Unternehmen stellte fest: Prozesse unterstützen Innovation – aber echtes, kontinuierliches Wachstum wird von Menschen angetrieben.
Für Chiara Fabrizi, Innovation Manager bei RHI Magnesita, ist Innovation im Kern Menschenführung. „Wir glauben wirklich an die Kraft der Motivation, denn Menschen sind der Kern des Innovierens“, sagte sie im Webinar. „Innovation gelingt, wenn Menschen sich anerkannt, gehört und motiviert fühlen.“
Diese Überzeugung prägt jede Initiative des Unternehmens.
Quick Article Takeaways:
- Der Grund, warum viele Innovationsprojekte scheitern: Sie konzentrieren sich ausschließlich auf Technologie – nicht auf die Menschen, die Ideen vorantreiben.
- RHI Magnesita setzt konsequent auf einen People-First-Ansatz und verknüpft Mitarbeitermotivation direkt mit Innovationserfolg.
- Transparentes Feedback und Anerkennung halten Teilnehmende engagiert und stärken Vertrauen.
- Strategische Ausrichtung sorgt dafür, dass Innovationsbemühungen sich auf wirkungsstarke Bereiche wie Nachhaltigkeit und Effizienz konzentrieren.
- Vielfältige Teams erzeugen kreative Lösungen – wenn sie durch bewusste Strukturen und Plattformen unterstützt werden.
Warum Mitarbeitermotivation wichtiger ist als Methodik
Plattformen und Prozesse sind nur ein Teil der Gleichung. Der wahre Motor der Innovation ist intrinsische Motivation. Mitarbeitende beteiligen sich eher an freiwilligen Programmen (wie der Einreichung von Verbesserungsideen), wenn sie den Wert ihrer Beiträge erkennen und eine Verbindung zur Mission des Unternehmens sehen. Dieses Prinzip deckt sich mit Forschungsergebnissen, wonach Unternehmen mit hoch engagierten Mitarbeitenden signifikante Gewinne erzielen.
Im Webinar betont Chiara, dass Engagement schwindet, sobald Menschen sich nicht gesehen fühlen. „Selbst die motiviertesten Menschen verlieren ihre Motivation, wenn sie kein Feedback oder keine Anerkennung erhalten“, erklärt sie. Sie weist außerdem auf ein zentrales Risiko hin: „Menschen hören auf, Ideen einzureichen, wenn sie sehen, dass es kein Follow-up gibt.“
RHI Magnesitas Erkenntnis daraus führt zu einem strategischen Fokus auf Menschen: Die Innovationsprogramme gehen weit über reine Ideengenerierung hinaus. Sie fördern aktiv Neugier, Zusammenarbeit und ein Gefühl von gemeinsamer Verantwortung. Besonders wichtig ist es, das Fachwissen der Mitarbeitenden zu nutzen, die ständig neue Perspektiven und Wissen einbringen.
Entdecken Sie bewährte Strategien zum Aufbau mitarbeitergetriebener Innovationsprogramme, die intrinsische Motivation freisetzen.
Der Feedback-Loop-Effekt: Transparenz schafft Vertrauen
Eine der herausragenden Praktiken bei RHI Magnesita ist ein strukturierter, transparenter Feedbackprozess. Jede eingereichte Idee durchläuft einen Bewertungsfunnel – und Mitarbeitende erhalten klare Erklärungen, warum Ideen umgesetzt werden oder nicht.
„Wir versuchen immer, den Prozess transparent zu gestalten, damit Einreichende wissen, wo ihre Idee steht“, erklärt Chiara. Sie ergänzt: „Wir geben Gründe dafür, warum manche Ideen weiterkommen und andere nicht (…) Eine Plattform ist äußerst hilfreich, um Vertrauen und Motivation aufrechtzuerhalten, weil sie sehr transparent ist und alles dort dokumentiert wird.“
Hier ist Feedback nicht nur formal – es verbindet Menschen mit dem größeren Ganzen. Teilnehmende erkennen durch konkrete Resultate die Wirkung ihrer Ideen, zum Beispiel durch:
- Kosteneinsparungen
- Effizienzsteigerungen und neue Materialentwicklungen
- Verbesserungen der Sicherheit (ein Top-Priorität in der Fertigung)
- Nachhaltigkeitsmaßnahmen (z. B. höhere Recyclingquoten, Energieeffizienz)
Die Grundlagen eines effektiven Ideenmanagements zu verstehen, hilft Unternehmen, typische Fallstricke zu vermeiden.
Um Teilnahme und Innovationskultur langfristig zu stärken, sorgt RHI Magnesita für Sichtbarkeit und Anerkennung der Einreichenden. Das Unternehmen bewirbt Challenges sowie erfolgreiche Lösungen über interne Kanäle, darunter Videos und Posts. Zusätzlich wurden monetäre Anreize im Rahmen des Ideenmanagements eingeführt – insbesondere für Mitarbeitende in den Produktionsbereichen (auf dem Shopfloor), um deren Motivation zu erhöhen.
Silos abbauen und Zusammenarbeit fördern
RHI Magnesita ist weltweit tätig, über Kontinente und Kulturen hinweg – mit Mitarbeitenden, die unterschiedliche Sprachen sprechen und in verschiedensten Umgebungen arbeiten. Diese globale Vielfalt ist ein enormer Vorteil, bringt aber auch Herausforderungen mit sich, wie Kommunikationsbarrieren oder isoliertes Wissen.
Um das interne Fachwissen zu nutzen und einen gemeinsamen, vernetzten Raum für Ideen zu schaffen, führte das Unternehmen die Idea Factory Plattform, gehostet von innosabi, ein. Diese ist nicht nur ein Sammelpunkt für Ideen – sie ist eine vollwertige End-to-End-Plattform, die Ideen vom ersten Funken über ihre Ausarbeitung und Inkubation hinweg bis zum Nachweis ihres Unternehmenswerts begleitet.
Die Plattform bietet entscheidende Funktionen für eine vielfältige Belegschaft:
- Zugang für Mitarbeitende ohne Firmen-E-Mail-Adresse (wichtig für Shopfloor-Personal)
- Eingebaute Übersetzungsfunktionen zur Überwindung von Sprachbarrieren
- Automatisierte, benutzerfreundliche Workflows für den gesamten Bewertungsprozess
- Einen intuitiven Raum für Austausch und Wissenstransfer
Verwandeln Sie alltägliche Herausforderungen in bahnbrechende Lösungen. Sehen Sie sich das vollständige Webinar mit Chiara von RHI Magnesita an und erfahren Sie, wie die Idea Challenge Plattform Teams motiviert, inkrementelle und disruptive Innovation verbindet und globale Zusammenarbeit fördert.
Die Synergie aus Motivation und Technologie in der Praxis
Die Idea Factory Plattform ist das technologische Rückgrat – doch wie bereits erwähnt, hängt der Erfolg des Unternehmens von der People-First-Strategie ab, die ihre Nutzung antreibt.
Initiativen wie die Idea Challenges wurden zu globalen, preisgekrönten Programmen, weil sie Technologie mit menschlicher Motivation verbinden. Die Challenge-Initiative – in der jeder Mitarbeitende ein Problem einreichen kann, das die globale Gemeinschaft lösen soll – erhielt 2025 den prestigeträchtigen Global Award for Culture, gewählt sowohl von Mitarbeitenden als auch vom Executive Management Team (EMT).
Dieser Erfolg zeigt, dass der Ansatz wirksam:
- Silos abbaut: Challenges und Ideen kommen aus allen Regionen – Europa, Südamerika, Nordamerika und zunehmend weiteren Kontinenten. Innovation entsteht nicht nur in F&E, sondern in diversen Abteilungen.
- An Strategie anknüpft: Challenges fokussieren bewusst auf Probleme mit hohem Potenzial, die direkt mit der Unternehmensstrategie verknüpft sind – etwa Recycling, Energieeffizienz oder KI. Dadurch fließen Ressourcen in die wirklich relevanten Themen.
Mitarbeitende erleben, dass ihre Beiträge zählen, erhalten Feedback und verfolgen, wie Ideen vom Konzept zur realen Wirkung heranwachsen – was eine Kultur kontinuierlicher Verbesserung etabliert.
Vier zentrale Learnings von RHI Magnesita über menschenzentrierte Innovation
Lesson 01: Innovation ist ein menschliches Unterfangen
Technologie allein hält Engagement nicht aufrecht. Anerkennung, transparentes Feedback und kontinuierliche Sichtbarkeit von Beiträgen sind entscheidend.
Lesson 02: Innovation mit Strategie verknüpfen (aber persönlich bleiben)
Mitarbeitende engagieren sich stärker, wenn ihre Ideen mit der Unternehmensmission verbunden sind und sich auf strategische, hochrelevante Probleme beziehen – etwa Nachhaltigkeit oder Effizienz.
Lesson 03: Ergebnisse feiern und kommunizieren
Die Messung von Wertschöpfung – finanziell wie nicht-finanziell – und die Kommunikation dieser Ergebnisse zurück an die Community fördern kontinuierliche Teilnahme und stärken die Kultur.
Lesson 04: Vielfalt befeuert Kreativität
Multikulturelle Teams bringen unterschiedliche Perspektiven ein. Aber es braucht bewusste Strukturen und Plattformen (wie die Idea Factory), um diese Vielfalt wirksam zu nutzen – indem Sprach- und Zugangsbarrieren abgebaut werden.
Chiara’s Erfahrung zeigt: In Menschen zu investieren zahlt sich aus. Wenn Mitarbeitende sich gesehen, gehört und wertgeschätzt fühlen, innovieren sie mit Energie, Kreativität und Engagement.
Takeaway: Tools können Innovation organisieren und nachverfolgen – aber sie motivieren nicht. Für nachhaltige Wirkung müssen Unternehmen robuste Systeme mit einer Kultur verbinden, die Teilnahme feiert, transparentes Feedback gibt und die Arbeit der Menschen mit dem Unternehmenszweck verbindet.
Abschließende Gedanken
Innovation ist ein lebendiger Prozess, geprägt von den Menschen, die ihn vorantreiben. RHI Magnesita zeigt, dass Unternehmen enorme Kreativität und Problemlösungskraft freisetzen, wenn sie verstehen, was Mitarbeitende wirklich motiviert – weit über das hinaus, was eine Plattform allein leisten kann.
Die wichtigste Erkenntnis ist nicht, einfach die richtigen Tools zu wählen – sondern eine Kultur zu schaffen, in der Neugier, Zusammenarbeit und Sinnhaftigkeit natürlich gedeihen. Am Ende basiert Erfolg nicht auf der fortschrittlichsten Technologie – sondern darauf, Menschen zu priorisieren und Innovation durch sie entstehen zu lassen.
Transformieren Sie Ihre Innovationskultur
innosabi stellt die Innovation Management Platform (IMP) bereit, die als technologisches Rückgrat für die preisgekrönten Initiativen von RHI Magnesita diente. Entdecken Sie, wie Sie ein robustes System implementieren können, das Ihre People-First-Strategie stärkt, Engagement fördert und messbare Wirkung erzielt.
Kontaktieren Sie innosabi für eine personalisierte Demo.
FAQs
Warum scheitern viele Ideenplattformen im Unternehmenskontext, obwohl sie moderne Technologie nutzen?
Weil sie sich oft zu sehr auf Prozesse und Tools konzentrieren – und Motivation, Anerkennung und Engagement der Mitarbeitenden vernachlässigen.
Wie können kleinere Unternehmen ohne große Budgets einen People-First-Ansatz verfolgen?
Durch kostengünstige Anreize, öffentliche Anerkennung, Peer-Feedback und das Ausrichten von Ideen an den wichtigsten Unternehmenszielen.
Wie lässt sich Innovationsdynamik aufrechterhalten, wenn die anfängliche Begeisterung nachlässt?
Regelmäßige Anerkennung, transparente Fortschritts-Updates, wiederkehrende Challenges und die Verknüpfung von Ideen mit strategischem Wert.
Welche typischen Hürden hindern Mitarbeitende daran, Ideen zu teilen – selbst mit einer Ideenplattform?
Mangelndes Feedback, unklare Zielsetzung, der Eindruck, dass Ideen nicht umgesetzt werden, oder eine Kultur, die das Äußern von Vorschlägen nicht fördert.
Welche Rolle spielen Führungskräfte bei der Förderung einer menschenzentrierten Innovationskultur?
Sie können coachen, Anerkennung geben, Neugier vorleben und sicherstellen, dass Mitarbeitende das Gefühl haben, dass ihre Beiträge wichtig sind.